Der lange Weg zu einer linken Haltung zur NATO
von Christoph Spehr
Das Verhältnis zur NATO ist eine der schwierigsten Fragen für die deutsche Linke. In der Partei Die Linke erzeugten die unterschiedlichen Erfahrungen und Prägungen der beiden Quellparteien in vielen programmatischen Bereichen eine produktive Spannung, die zu einer offenen programmatischen Entwicklung beitrug. Beim Thema NATO wirkten dagegen die traditionelle Ostbindung der ostdeutschen Gesellschaft und der traditionelle US-kritische Antiimperialismus der Westlinken in dieselbe Richtung. Eine kritische Überprüfung bisheriger Positionen bis hin zu einer möglichen Neupositionierung war daher besonders tabuisiert.
Erschwerend kam hinzu, dass die Haltung der Linken zur deutschen NATO-Einbindung von erheblicher Bedeutung dafür war, ob es eine realistische Perspektive auf eine Regierungskoalition links von der CDU auf Bundesebene geben könnte. „Die Außenpolitik der Linken wird – wenn nicht einschneidende Dinge geschehen – verhindern, dass Angela Merkel als Kanzlerin abgelöst werden kann“, notierte Elisabeth Niejahr vor dem Göttinger Parteitag der Linken 2015 in der ZEIT.[1] Es sollte sich herausstellen, dass sie damit recht behielt.
Die Haltung der NATO als Frage der innerparteilichen Strategie
Die SPD hatte 2013 mit einem Bundesparteitagsbeschluss ihre bisherige Haltung aufgegeben, eine Koalition mit der Linken auszuschließen, dafür aber – wenig überraschend – neben einer verlässlichen parlamentarischen Mehrheit gefordert, dass „eine verantwortungsvolle Europa- und Außenpolitik im Rahmen unserer internationalen Verpflichtungen gewährleistet“ sein müsse.[2] Die SPD-Linke legte kurz darauf nach mit dem Papier „Für eine linke Reformperspektive“: Für ein „progressiv-linkes Reformbündnis mit einer Machtperspektive 2017“ müsse jetzt ein „offener und konstruktiver Diskussionsprozess“ zwischen „allen Parteien links der Union“ eröffnet werden, und zwar „schnell“.[3]
Damit geriet die Friedensfrage in die Mühlen der Ost-West-Kämpfe, des Streits um die Regierungsbeteiligung und der Auseinandersetzungen um die Identität der Partei, was beiden nicht guttat: Der Friedensfrage und der Partei.
Dabei kam es zu einer bemerkenswerten Verschiebung der Fronten. Zum Zeitpunkt der Fusion waren die friedenspolitischen Positionen der PDS erheblich dezidierter als die der WASG. Das PDS-Programm von 1999 und 2003 forderte ein Verbot des Bundeswehreinsatzes im Ausland, das Verbot aller Waffenexporte, die Beendigung von Militärhilfe und formulierte das Ziel einer Auflösung der NATO „und ihre Ersetzung durch weltweite und gesamteuropäische kooperative Sicherheitssysteme, insbesondere durch eine demokratische Reform der UNO und die Weiterentwicklung des KSZE-Prozesses.“[4] Im Gründungsprogramm der WASG war die Forderung nach NATO-Austritt dagegen nicht enthalten. Das Programm wandte sich lediglich „gegen den Umbau von NATO und Bundeswehr zu flexiblen, schnell einsetzbaren Interventionsarmeen.“[5] Ansonsten teilte es mit dem PDS-Programm die Ablehnung von Aufrüstung und Out-of-area-Einsätzen der NATO (also von Kampfeinsätzen jenseits des NATO-Vertragsgebiets[6]) sowie die Betonung des Völkerrechts als Grundlage. Das Wahlprogramm der Linken zur Bundestagswahl 2005 und die „programmatischen Eckpunkte“ forderten allgemein, „Militärbündnisse“ wie die NATO zu überwinden. Das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2009 übernahm die PDS-Formulierung von der Auflösung der NATO und ihrer Ersetzung durch ein „kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands“.[7] Im Europawahlprogramm 2009 wurde die NATO-Auflösung noch deutlicher nicht als Forderung, sondern als „Ziel“ bezeichnet.[8]

Das änderte sich mit dem Entwurf zum Grundsatzprogramm, das schließlich auf dem Erfurter Parteitag am 21.-23.10.2011 beschlossen wurde. Es verschärfte die Position durch die Forderung, die seither in allen Wahlprogrammen zu Bundes- und Europawahlen (mit Ausnahme des Europawahlprogramms 2024) zitiert wurde: Die Linke werde „in jeder politischen Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen des Militärbündnisses austritt und die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO entzogen wird.“[9] Während die WASG in der NATO-Frage eher gelassen operiert hatte, wurde die scharfe Haltung zur NATO jetzt vor allem aus den West-Landesverbänden eingefordert.
Der „Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO“
Während seit ihrer Gründung noch nie ein Mitglied aus der NATO ausgetreten ist, ist der Austritt aus den militärischen Strukturen mehrfach vorgekommen. Frankreich verließ 19666 die militärische Kommandostruktur der NATO (und kehrte 2009 wieder zurück), Griechenland 1974 (bis 1981), Spanien 1986 (bis 1999). Der Rückzug aus der militärischen Struktur ändert nichts an der grundsätzlichen Beistandspflicht im Bündnisfall. Er ändert auch nicht an den Grundprinzipien der NATO, wonach einerseits über den Bündnisfall in den zivilen Strukturen im Konsens entschieden wird und andererseits jedes Mitglied selbst entscheidet, welchen Beitrag es zur Unterstützung leistet.
Die Bundeswehr steht auch nicht, wie die Programmpassage suggeriert, als Ganzes unter dem „Oberkommando der NATO“. Richtig ist aber, dass die Bundeswehr bereits im Frieden Teile ihrer Streitkräfte dem gemeinsamen NATO-Kommando unterstellt (insbesondere im Bereich von Flotte und Luftwaffe) und im Kriegsfall der operativen Führung durch die NATO-Strukturen unterstellen würde (an der Deutschland wiederum beteiligt ist). Der Parlamentsvorbehalt und die deutsche Befehls- und Kommandogewalt (die im Frieden beim Verteidigungsminister und im Krieg beim Bundeskanzler liegt) werden dadurch aber nicht außer Kraft gesetzt; die NATO kann die Bundeswehr nicht von sich aus mobilisieren oder befehligen. Mit dem Austritt aus den militärischen Strukturen geht in der Tat üblicherweise einher, sich nicht an der gemeinsamen militärischen Koordination zu beteiligen, keine NATO-Truppen zu stellen, nicht an Manövern teilzunehmen und keine Stützpunkte der NATO oder von NATO-Partnern im Land zuzulassen.
Der Austritt aus den militärischen Strukturen ist so der stärkste Akt der Distanzierung, der innerhalb des Militärbündnisses möglich ist. Die Zuspitzung darauf ist weitaus realistischer und unmittelbarer als die bloße Zielangabe, Militärbündnisse allgemein oder die NATO konkret überwinden zu wollen. Die neue Forderung erschwerte damit eine mögliche Regierungszusammenarbeit mit der SPD erheblich und absichtlich.
Gegen den friedens- und sicherheitspolitischen Teil des Programmentwurfes hatte sich vor allem das Forum Demokratischer Sozialismus gewandt, ein überwiegend ostdeutsch zusammengesetzter Zusammenschluss von Reformern. Sie plädierten dafür, „Aussagen mit hoher Konkretisierung“ etwa zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr oder zum NATO-Austritt der weiteren Diskussion zu überlassen und nicht im Grundsatzprogramm festzuschreiben. Immerhin sei es schwierig, sich zur UN-Charta zu bekennen und gleichzeitig UN-mandatierte Friedenseinsätze jeglicher Art pauschal abzulehnen. Welche Rolle Sicherheitspolitik im Rahmen einer anzustrebenden „Weltinnenpolitik“ einnehmen könne und müsse, sei bislang kaum diskutiert. Auch könne man die Tatsache, dass breite Bevölkerungsmehrheiten in unterschiedlichsten NATO-Mitgliedsstaaten „mit dieser Institution (…) ihr Sicherheitsbedürfnis verbinden“, nicht einfach ignorieren.[10]
Letztlich verzichtete das fds auf dem Erfurter Parteitag auf die außenpolitische Konfrontation und konzentrierte sich auf das Aufweichen der sogenannten Haltelinien für Regierungsbeteiligungen auf Landesebene. Damit folgten alle der Logik des Erfurter Parteitags, die Existenz unterschiedlicher Strategien bei Ost- und Westlandesverbänden zu akzeptieren und sich auf den Kompromiss zu einigen: Regierungsbeteiligungen auf Landesebene können von Landesverbänden aktiv angestrebt werden, Regierungsbeteiligungen auf Bundesebene werden nicht vorbereitet.[11]
Zehn Jahre Stagnation
Der Preis dieses Kompromisses waren zehn Jahre außenpolitische Stagnation bei der Linkspartei. Das außenpolitische Weltbild der ost- wie westdeutschen Linken war geprägt von den 1990er Jahren. Nach dem Ende des Kalten Krieges befand sich die NATO objektiv in einer Sinn- und Funktionskrise. Die Friedensdividende war enorm, die deutschen Rüstungsausgaben sanken von 3 Prozent des BIP in den 1980ern auf 1,4 Prozent bis 1999. Die Zusammenarbeit mit Russland war relativ eng, ein russischer NATO-Beitritt durchaus eine denkbare Möglichkeit. Die Militärausgaben und das Bruttonationalprodukt von China betrugen ein Zehntel der USA.
Nicht nur der Linken kam die NATO zu dieser Zeit überflüssig vor. Sie endete mit neuen Kriegen: dem völkerrechtswidrigen out-of-area-Angriff der NATO gegen Serbien im Kosovokrieg, dem Terroranschlag vom 11.September 2001 gegen die USA, dem darauffolgenden Afghanistankrieg (dem bislang einzigen von der NATO erklärten Bündnisfall), dem US-amerikanischen Krieg gegen den Irak 2003 (der völkerrechtswidrig war und die NATO effektiv spaltete), dem UN-mandatierten NATO-Krieg gegen Libyen 2011 und dem Kampfeinsatz gegen den Islamischen Staat 2014-2019 (ohne UN-Mandat, ohne NATO-Beschluss, aber mit deutscher Beteiligung).
Der eigentliche Einschnitt aber war die russische Annexion der Krim 2014 und die russische Intervention im Donbass. Den Mitgliedsstaaten wurde klar, dass die NATO – durch die Umorientierung auf globale Interventionsfähigkeit und den langjährigen Abbau ihrer Streitkräfte – zu einer territorialen Verteidigung gegen einen konventionellen Angriff nicht mehr ausreichend in der Lage wäre. Erste Reaktionen darauf waren die Verstärkung der NATO-Präsenz in Polen und den baltischen Staaten und das sogenannte 2-Prozent-Ziel, d.h. die geplante Wiederanhebung der Rüstungsausgaben auf 2 Prozent des BIP in allen Mitgliedsstaaten.
Die Linke hatte zu den veränderten globalpolitischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen nicht viel zu sagen. In den entscheidenden Jahren 2013-2017 verpasste die Linke den Anschluss an die außen- und sicherheitspolitische Debatte, ebenso wie an die Friedens- und Konfliktforschung. Zwischen 2017 und 2021 verfestigte sich der Eindruck, dass die Linke sicherheitspolitisch nicht wusste, was sie wollte, und von der weltpolitischen Dynamik zunehmend überfordert war. 2014 stimmte die Linksfraktion im Bundestag mehrheitlich gegen die Beteiligung einer deutschen Bundeswehr-Fregatte am maritimen Begleitschutz bei der Vernichtung syrischer Chemiewaffen an Bord des US-Schiffs „Cape Ray“, was niemand verstand. Von da führte eine gerade Linie zur ebenfalls völlig uneinheitlichen Stimmabgabe der Linksfraktion beim Bundeswehr-Mandat für die militärische Evakuierung aus Afghanistan und der Tatsache, dass man die mehrheitlich gewählte Enthaltung auch niemand erklären konnte.
Die friedenspolitische Debatte in der Partei fand nicht statt und blieb reduziert auf die Frage des NATO-Austritts, der weiterhin ein Codewort für die Haltung zu einer möglichen Regierungsbeteiligung blieb, obwohl die Forderung an sich immer weniger in die politische Landschaft passte. Während sich Gregor Gysi öffentlich gegen die Forderung nach Austritt aus den militärischen NATO-Strukturen äußerte[12], zimmerte die Bundestagsfraktion gleichzeitig genau diese Forderung in einem Bundestagsantrag fest.[13] Auch dieses Prinzip wiederholte sich vor der Bundestagswahl 2021. Während Katja Kipping, Ex-Parteivorsitzende und Berliner Senatorin, feststellte: „Unsere Programmaussage zur NATO ist von der Zeit überholt“[14], erschien zum September 2020 eine von 26 MdB, 12 Mitgliedern des Parteivorstands und Landesvorsitzenden aus 8 Bundesländern gezeichnete Erklärung, die den Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO als Teil des „Gründungskonsens der Partei“ und „Lackmusstest unserer friedenspolitischen Glaubwürdigkeit“ bezeichnete.[15]
Zerbrechende Gewissheiten: Der Ukrainekrieg 2022
Der russische Angriff auf die Ukraine am 24.Februar 2022 war von kaum jemand für möglich gehalten worden. Er schuf Realitäten und zeigte Entwicklungen auf, an denen man nicht mehr vorbeikam: Die Bereitschaft Russlands, sinkende ökonomische Bedeutung durch aggressive regionale Expansion und militärische Unkalkulierbarkeit zu kompensieren; die Bedeutung Chinas als inzwischen einziger Großmacht auf Augenhöhe mit den USA und einer globalen Strategie der Einflusssicherung; die Widersprüche zwischen den Großmachtansprüchen auf regionale Einflusssphären und den Souveränitätsansprüchen ihrer Anliegerstaaten; die Widersprüche zwischen den Prinzipien des Völkerrechts und einer Strategie der Nichteinmischung; neue Kriegsrisiken, die aus dem Übergang zur innovationsgetriebenen Ökonomie entstanden (der russische Kampf gegen die postfossile Transformation oder die strategische Bedeutung Taiwans für die Informationsindustrie), aber auch neue Chancen, die aus dem gewachsenen Selbstbewusstsein vieler Staaten bis zu den Großmächten in zweiter Reihe entstehen können, sich nicht in eine Neuaufteilung der Welt in US-amerikanische, chinesische oder russische Einflusssphären einbinden lassen zu wollen. Die Welt des Kalten Kriegs existierte erst jetzt endgültig nicht mehr, und für die neue Welt mussten Antworten gesucht werden.
Die Linke war auf die Infragestellung des bisherigen globalpolitischen Weltbildes besonders schlecht vorbereitet. Das Konservieren bisheriger außenpolitischer Glaubenssätze war nur noch um den Preis der Realitätsverweigerung und des Aufgebens von Prinzipien wie internationalistischer Solidarität zu haben. Gerade die deutsche Linke musste sich die Frage gefallen lassen, ob die bisherige Positionsbildung (einseitige Abrüstung, hohe Akzeptanz von russischen „Sicherheitsinteressen“, geringes Interesse an Sicherheitsinteressen der osteuropäischen Staaten) tatsächlich friedenspolitisch motiviert war oder nicht eher Ausdruck von nationalem Egoismus, nach dem Motto: Die NATO ist teuer, wir brauchen sie nicht, und was kümmern uns die baltischen Staaten oder Georgien.
Die Frage, zu der man sich unmittelbar verhalten musste, war nicht die nach dem NATO-Austritt, sondern die nach der Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen. In dieser Situation forderten die linken Regierungsländer Thüringen, Berlin und Bremen, dass man sich nicht auf Solidaritätsdemonstrationen mit der Ukraine stellen könne mit der Position, der Ukraine jede militärische Unterstützung zu verweigern: „Die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine [ist] der Elefant im Raum. Der Versuch, die LINKE darüber friedenspolitisch zu profilieren, dass sie solche Lieferungen unter allen Umständen ablehnt, muss scheitern, denn er geht an der Wirklichkeit vorbei (…) Es ist notwendig, eine Ausnahme von der Regel für unsere Positionsbildung anzuwenden, um weiterhin als politische Kraft ernst genommen zu werden.“[16] Der Bremer Landesverband fasste einen Parteitagsbeschluss, in dem es hieß: „Wir können uns nicht dagegen stellen, dass die Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Einmarsch Waffenlieferungen in Anspruch nimmt.“[17] Ähnliche Positionen wurden auch im Rahmen des Netzwerks der Progressiven Linken vertreten, auch wenn es hierzu keine einheitliche Position des Netzwerks gab.
Im Endeffekt gelang zwar nicht, eine entsprechende Positionierung der Linken durchzusetzen. Aber es gelang, die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine zu enttabuisieren und aus dem üblichen Verdikt der Kriegstreiberei herauszuholen. Insgesamt dürfte die Auseinandersetzung dazu beigetragen haben, dass die Linke mit deutlichen Mehrheiten den russischen Angriffskrieg verurteilte, Sanktionen befürwortete – und dass auf dem Europaparteitag im November 2023 die Forderung nach dem NATO-Austritt nicht mehr ins Wahlprogramm kam.[18]
Das Ende der ohnmächtigen Mobilisierung
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch auf europäischer Ebene dazu geführt, dass die politischen Antworten der europäischen Linksparteien derzeit nicht zur Deckung zu bringen sind – im Unterschied zu belastbaren Übereinstimmungen in der sozialen und ökologischen Programmatik. In Finnland hat die Linksfraktion dem NATO-Beitritt mehrheitlich zugestimmt, in Schweden nicht. Die Linken in Polen und den baltischen Ländern sehen in der NATO eine notwendige Schutzmacht und befürworten, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Die Linksparteien in Großbritannien, Spanien und Zypern lehnen dagegen sogar die Sanktionen gegen Russland ab.[19]
Es wäre die Aufgabe der deutschen Linkspartei, in dieser Situation Brücken zwischen den europäischen Linksparteien und Brücken zur Realität zu bauen. Dafür wäre es erforderlich, Militärbündnisse wie die NATO als ein schwieriges, aber notwendiges Element auf dem Weg zu einer internationalen Friedensordnung zu begreifen und als eine Möglichkeit, dominierende Großmächte in breitere nationale Interessen einzubinden und für ihre Bindung an Völkerrecht und UN-Strukturen zu kämpfen, anstatt für den Austritt. Man müsste zur Kenntnis nehmen, dass die flapsige Beschreibung des Sinns der NATO: „to keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down“[20], ziemlich nah an den heutigen politischen Bedürfnissen vieler osteuropäischer Staaten liegt und dass eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur mit Russland derzeit ein Fernziel ist, das auf absehbare Zeit kein gemeinsames Militärbündnis mit Russland meinen kann und nur noch im Kontext einer globalen Sicherheitsarchitektur unter Einschluss von China und wesentlicher Schwellen-Großmächte zu erreichen ist. Man müsste, statt sich am 2-Prozent-Ziel abzuarbeiten, den Mut haben darüber zu reden, dass die derzeitige Rüstungspolitik der NATO-Länder ökonomisch ineffizient ist: „Über die stärkere Integration militärischer Beschaffung und Produktion sowie die nationale Spezialisierung militärischer Kapazitäten ließe sich viel Geld einsparen“[21] und damit – von links gedacht – der Druck auf andere Haushaltsausgaben verringern. Und man müsste über eine Militärstrategie reden, die strikt defensiv ist, aber dennoch oder gerade deswegen in der Lage ist, Nicht-Mitgliedsstaaten Sicherheitsgarantien anzubieten und dem regionalen Expansionsdruck aufstrebender Großmächte etwas entgegenzusetzen.
Voraussetzung dafür wäre, die NATO-Frage aus der Strategie der ohnmächtigen Mobilisierung zu befreien, in der sie seit der Gründung der Linken gefangen gehalten wird. Ohnmächtige Mobilisierung ist der Versuch, Zustimmung zu generieren über Positionen, die eine hohe moralische Resonanz im politischen Unterbewussten haben, für die man aber keinerlei Realisierungsweg anbieten kann und will – nicht nur, weil es dafür keine politischen Bündnispartner gibt, sondern weil man sie auch mit einer linken Alleinregierung beim besten Willen nicht umsetzen könnte und dürfte. Dass das Europawahlprogramm 2024 der Linken das erste Programm seit 2011 ist, das auf die rituelle Forderung nach dem Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO verzichtet, ist ein Anfang.
Eine Fassung dieses Textes in englischer Sprache erscheint in Kürze auf https://rosalux-geneva.org.
[1] Elisabeth Niejahr: Gregor Gysi – Er will nur spielen, ZEIT 3.06.2015
[2] „Perspektiven. Zukunft. SPD!“, Beschluss IA1 des Bundesparteitags der SPD 14.-16.11.2013 in Leipzig (Leitantrag des Parteivorstands)
[3] Für eine linke Reformperspektive, 31.01.2014. Das Papier war von 22 SPD-Mitgliedern namentlich unterzeichnet, darunter 15 MdBs inklusive der Parlamentarischen Geschäftsführerin Bärbel Bas und dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Niels Annen, 4 Landesvorsitzende, darunter Ralf Stegner, den Bundesvorsitzenden von Jusos, ASF und DL21.
[4] Parteiprogramm der PDS, beschlossen 29.-31.01.1999. Das PDS-Parteiprogramm von 2003 präzisierte noch, dass auch Auslandseinsätze nach Chapter VII der UN-Charta, also Blauhelmeinsätze mit UN-Mandat, ausgeschlossen werden.
[5] Gründungsprogramm der WASG, beschlossen in Dortmund am 6.-08.05.2005
[6] Das NATO-Vertragsgebiet ist im NATO-Vertrag definiert als der Bereich, für den die gemeinsame Bündnisverpflichtung besteht. Es schließt außer dem Festland der Mitgliedsstaaten ihnen zugehörige Inseln nördlich des Wendekreises des Krebses ein, also die Kanaren, aber nicht das spanische Ceuta oder die britischen, französischen und niederländischen Karibikinseln.
[7] Wahlprogramm der Linken zur Bundestagswahl 2009
[8] Wahlprogramm der Linken zur Europawahl 2009
[9] Grundsatzprogramm der Linken, beschlossen in Erfurt 21.-23.10.2011
[10] 13 Thesen des Forum Demokratischer Sozialismus (fds) zum Entwurf des Programms der Partei DIE LINKE – Langfassung, beschlossen vom Bundesvorstand des fds am 28. August 2010
[11] Für die ostdeutschen Landesverbände stand die Überwindung des SED-Stigmas im Vordergrund, weshalb die Enttabuisierung und Anerkennung durch Regierungsbeteiligungen ein zentrales strategisches Ziel war. Die westdeutschen Landesverbände hatten nur ein kurzes, in den Übergangsbestimmungen der Satzung verankertes, Zeitfenster, um so zu wachsen, dass sie in der neuen Partei nicht von den Ostverbänden majorisiert wurden. Das Mittel der Wahl dafür war, vor allem enttäuschte SPD-Anhänger gewinnen zu wollen, indem man sich als eine Art SPD vor dem Sündenfall anbot, sprich vor der Agenda 2010 und der Teilnahme am Kosovokrieg. Kooperation mit der SPD passte nicht in diese Strategie.
[12] Weser-Kurier, 26.11.2016
[13] Die NATO durch ein kollektives System für Frieden und Sicherheit in Europa unter Einschluss Russlands ersetzen, Antrag der Fraktion Die Linke vom 2.06.2016, Drs. 18/8656
[14] https://www.n-tv.de/politik/Kipping-Linke-muss-NATO-Position-ueberdenken-article24012204.html
[15] Auslandseinsätze beenden – Rüstungsexporte verbieten! Erklärung zum Antikriegstag, 1.09.2020
[16] Auf komplizierte Situationen passen keine einfachen Antworten, 17.06.2022, veröffentlicht auf links-bewegt.de. Das Papier war gezeichnet vom thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, den Minister*innen Klaus Lederer und Claudia Bernhard, sowie den Bremischen Fraktions- und Landesvorsitzenden.
[17] Den russischen Angriffskrieg zurückweisen, auf internationale Kooperation statt Aufrüstung setzen!
Beschluss des Landesparteitags Bremen vom 12. Juni 2022
[18] Wahlprogramm der Linken zur Europawahl 2024
[19] Cornelia Hildebrandt: Linke Unschärfen und Leerstellen, Neues Deutschland, 11.01.2023
[20] Lord Hastings Ismay, erster NATO-Generalsekretär, zitiert nach Simon Koschut: Baustelle NATO, Aus Politik und Zeitgeschichte, 15.11.2023
[21] Koschut, a.a.O.
Unsere Veranstaltung zu diesem Artikel:
Linke Sicherheitspolitik und die Haltung zur NATO
Rosalux jour fixe mit Christoph Spehr
Mittwoch, 24. April 2024, um 18:30 Uhr in Bremen, im Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Bremer Altstadt – Wir bitten um Anmeldung!
https://www.rosa-luxemburg.com/event/linke-sicherheitspolitik-und-die-haltung-zur-nato/
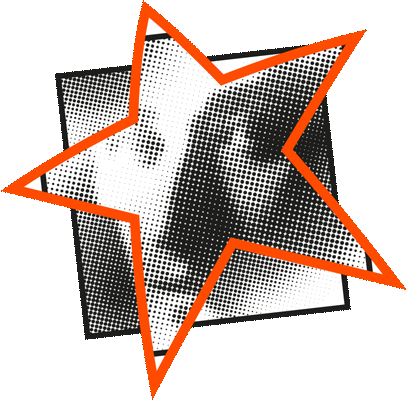

 RLI-News als RSS-Feed
RLI-News als RSS-Feed  Kalender abonnieren
Kalender abonnieren
Bislang kein Kommentar.